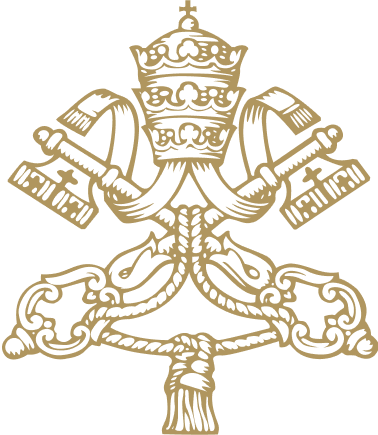ANSPRACHE DES HEILIGEN VATERS
anlässlich des Symposiums
„Auf dem Weg zu einer grundlegenden Theologie des Priestertums“
Audienzhalle
Donnerstag, 17. Februar 2022
_______________________________
Liebe Brüder, guten Tag!
Ich bin dankbar für die Gelegenheit, diese Überlegungen mit euch zu teilen, die sich aus dem ergeben, was der Herr mir in den mehr als 50 Jahren meines Priestertums nach und nach gezeigt hat. Von diesem dankbaren Gedenken möchte ich jene Priester nicht ausnehmen, die mir seit meiner Kindheit durch ihr Leben und ihr Zeugnis gezeigt haben, was das Antlitz des Guten Hirten ausmacht. Ich habe darüber nachgedacht, was ich heute über das Leben eines Priesters sagen möchte, und bin dabei zu dem Schluss gekommen, dass das beste Wort dem Zeugnis entspringt, das ich im Laufe der Jahre von so vielen Priestern erhalten habe. Was ich hier anbiete, ist die Frucht des Nachdenkens über sie, ein Erkennen und Betrachten der Eigenschaften, die sie auszeichneten und ihnen eine einzigartige Kraft, Freude und Hoffnung in ihrer pastoralen Sendung verliehen.
Gleichzeitig muss ich dasselbe über die Brüder im priesterlichen Dienst sagen, die ich begleiten musste, weil sie das Feuer der ersten Liebe verloren hatten und ihr Dienst unfruchtbar, einförmig und fast sinnlos geworden war. Der Priester durchläuft in seinem Leben verschiedene Zustände und Momente; ich persönlich habe verschiedene Zustände und Momente durchlebt, und beim „Wiederkäuen“ der Regungen des Geistes habe ich festgestellt, dass in manchen Situationen, auch in Momenten der Prüfung, der Schwierigkeit und der Trostlosigkeit, wenn ich das Leben auf eine bestimmte Weise gelebt und geteilt habe, der Friede geblieben ist. Ich bin mir bewusst, dass es viel über das Priestertum zu sagen und zu theoretisieren gäbe; heute jedoch möchte ich diese „kleine Ernte“ mit euch teilen, damit der Priester von heute, unabhängig von der Situation, in der er sich gerade befindet, den Frieden und die Fruchtbarkeit erfahren kann, die der Geist schenken will. Ich weiß nicht, ob diese Überlegungen der „Schwanengesang“ meines priesterlichen Lebens sind, aber ich kann euch versichern, dass sie aus meiner Erfahrung stammen. Ich trage hier keine Theorie vor, ich spreche von dem, was ich erlebt habe.
Die Zeit, in der wir leben, verlangt von uns nicht nur, den Wandel aufzufangen, es geht darum, ihn in dem Bewusstsein anzunehmen, dass wir vor einem Epochenwechsel stehen – das habe ich schon mehrmals wiederholt. Sollten wir daran gezweifelt haben, so hat Covid es mehr als deutlich gemacht, dass es hierbei um weit mehr geht als um eine Frage der Gesundheit, um weit mehr als um eine Erkältung.
Mit einem solchen Wandel kann man immer auf verschiedene Weise umgehen. Das Problem ist, dass viele Handlungen und Haltungen nützlich und gut sein mögen, aber nicht alle den Geschmack des Evangeliums haben. Und hier ist der entscheidende Punkt: die Veränderung und das Handeln, die den Geschmack des Evangeliums haben oder nicht haben, dies gilt es zu unterscheiden. Zum Beispiel die Suche nach festgelegten Formen, die sehr oft in der Vergangenheit verankert sind und uns eine Art Schutz vor Risiken „garantieren“ und Zuflucht nehmen in einer Welt oder einer Gesellschaft, die nicht mehr existiert (wenn sie überhaupt jemals so existiert hat), als ob diese bestimmte Ordnung in der Lage wäre, die Konflikte zu beenden, die uns die Geschichte vor Augen führt.Das ist die Krise des Rückwärtsgehens im Sinne einer Flucht.
Eine andere Haltung kann die eines übertriebenen Optimismus sein – „alles wird gut“ –; ohne Einsicht und ohne die erforderlichen Entscheidungen zu weit zu gehen. Dieser Optimismus lässt am Ende die Verwundeten dieses Wandels außer Acht, er kann die Spannungen, die Komplexität und die Mehrdeutigkeit der Gegenwart nicht akzeptieren und erhebt die letzte Neuheit zur wahren Wirklichkeit und verachtet damit die Weisheit der Jahre. (Es handelt sich um zwei Arten der Flucht; es sind die Verhaltensweisen des Söldners, der den Wolf kommen sieht und flieht: er flieht in die Vergangenheit oder er flieht in die Zukunft). Keine dieser beiden Haltungen führt zu ausgereiften Lösungen. Die Konkretheit der Gegenwart, dort müssen wir innehalten, die Konkretheit der Gegenwart.
Im Gegenteil, ich mag die Haltung, die aus der zuversichtlichen Annahme der Realität kommt und in der weisen und lebendigen Tradition der Kirche verankert ist, die es sich leisten kann, ohne Angst hinauszufahren. Ich spüre, dass Jesus uns in diesem Moment der Geschichte erneut einlädt, „hinauszufahren“ (vgl. Lk 5,4), im Vertrauen darauf, dass er der Herr der Geschichte ist und dass wir, von ihm geleitet, in der Lage sein werden, den Horizont zu erkennen, den wir durchlaufen müssen. Unser Heil ist kein steriles Heil aus einem Labor, nein, oder aus einem rein geistigen Spiritualismus – immer ist da die Versuchung des Gnostizismus, diese Versuchung ist modern, sie ist aktuell – ; den Willen Gottes zu erkennen bedeutet, zu lernen, die Wirklichkeit mit den Augen des Herrn zu deuten, ohne dass es notwendig ist, dem auszuweichen, was unserem Volk dort widerfährt, wo es lebt; ohne die Angst, die uns dazu bringt, einen schnellen und beruhigenden Ausweg zu suchen, der sich von der Ideologie des Augenblicks oder von einer vorgefertigten Antwort leiten lässt. Beide sind nicht in der Lage, die schwierigsten und sogar dunkelsten Momente unserer Geschichte zu bewältigen. Diese beiden Wege würden dazu führen, unsere Geschichte als Kirche zu verleugnen, »die ruhmreich ist, insofern sie eine Geschichte der Opfer, der Hoffnung, des täglichen Ringens, des im Dienst aufgeriebenen Lebens, der Beständigkeit in mühevoller Arbeit ist« (Apostolisches Schreiben Evangelii Gaudium, 96).
In diesem Zusammenhang ist auch das priesterliche Leben von dieser Herausforderung betroffen; ein Symptom dafür ist die Berufungskrise, von der unsere Gemeinschaften mancherorts heimgesucht werden. Es ist jedoch auch wahr, dass dies oft dem Fehlen eines ansteckenden apostolischen Eifers in den Gemeinschaften geschuldet ist, was bedeutet, dass sie keine Begeisterung wecken und wenig Anziehungskraft haben: funktionale Gemeinschaften, zum Beispiel, die gut organisiert sind, aber ohne Begeisterung, alles ist dort in Ordnung, aber es fehlt das Feuer des Geistes. Wo es Leben, Eifer und den Wunsch gibt, Christus zu den Mitmenschen zu bringen, entstehen echte Berufungen. Selbst in Pfarreien, in denen die Priester nicht sehr engagiert und freudig sind, ist es das geschwisterliche und glühende Gemeinschaftsleben, das den Wunsch weckt, sich ganz Gott und der Verkündigung des Evangeliums zu weihen, vor allem, wenn diese lebendige Gemeinschaft eindringlich um Berufungen betet und den Mut hat, ihren jungen Menschen einen Weg besonderer Hingabe vorzuschlagen. Wenn wir in den Funktionalismus, in die pastorale Organisation - alles und nur das - verfallen, zieht das die Menschen nicht an, aber wenn es einen Priester oder eine Gemeinschaft gibt, die diesen christlichen, von der Taufgnade herrührenden Eifer hat, gibt es eine Anziehungskraft für neue Berufungen.
Das Leben eines Priesters ist in erster Linie die Heilsgeschichte eines getauften Menschen. Kardinal Ouellet hat von dieser Unterscheidung zwischen dem Weihepriestertum und dem Priestertum aller Getauften gesprochen. Manchmal vergessen wir die Taufe, und der Priester wird zu einer Funktion: Funktionalismus, und das ist gefährlich. Wir dürfen nie vergessen, dass jede besondere Berufung, auch die zu den heiligen Weihen, die Vollendung der Taufe ist. Es ist immer eine große Versuchung, ein Priestertum ohne Taufe zu leben – und solche Priester „ohne Taufe“ gibt es – das heißt, ohne die Erinnerung daran, dass unsere erste Berufung die Berufung zur Heiligkeit ist. Heilig zu sein bedeutet, Jesus gleichgestaltet zu sein und ein Leben nach seiner Gesinnung zu führen (vgl. Phil 2,15). Nur wenn wir versuchen, so zu lieben, wie Jesus geliebt hat, machen auch wir Gott sichtbar und verwirklichen so unsere Berufung zur Heiligkeit. Der heilige Johannes Paul II. hat zu Recht daran erinnert, dass »der Priester wie die Kirche in dem Bewusstsein wachsen [muss], dass er es nötig hat, selbst ständig evangelisiert zu werden« (Nachsynodales Apostolisches Schreiben Pastores dabo Vobis, 25. März 1992, 26). Und dann geh du mal zu irgendeinem Bischof, zu irgendeinem Priester, und sag ihm, dass er evangelisiert werden muss... die verstehen das nicht. Und das passiert, das ist das Drama von heute.
Jede spezifische Berufung muss dieser Art von Unterscheidung unterzogen werden. Unsere Berufung ist in erster Linie eine Antwort auf den, der uns zuerst geliebt hat (vgl. 1 Joh 4,19). Und das ist die Quelle der Hoffnung, denn auch in der Krise hört der Herr nicht auf, zu lieben und deshalb Menschen zu berufen. Und dafür sind wir alle Zeugen: Eines Tages kam der Herr zu uns, dort wo wir waren und wie wir waren, in widersprüchlichen Kontexten oder mit komplexen Familiensituationen. Ich lese immer wieder gerne Ezechiel 16 und finde mich dann manchmal darin wieder: Er hat mich hier gefunden, er hat mich so gefunden, und er hat mich weitergebracht... Aber das brachte ihn nicht von seinem Willen ab, mit einem jeden von uns die Heilsgeschichte fortzuschreiben. Von Anfang an war das so – man denke an Petrus und Paulus, Matthäus..., um nur einige zu nennen. Ihre Erwählung beruhte nicht auf einer idealen Option, sondern auf einem konkreten Einsatz für jeden einzelnen von ihnen. Keiner muss sich angesichts seines Menschseins, seiner Geschichte und seines Charakters fragen, ob die eigene Berufungsentscheidung passend ist oder nicht, sondern ob diese Berufung in seinem Gewissen das Potential der Liebe freisetzt, das wir am Tag unserer Taufe empfangen haben.
In diesen Zeiten des Wandels gibt es viele Fragen und auch Versuchungen, denen man sich stellen muss. Deshalb möchte ich mich in diesem Beitrag einfach auf das konzentrieren, was ich für das Leben eines Priesters heute für entscheidend halte, und dabei berücksichtigen, was Paulus sagt: »In ihm – das heißt in Christus – wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn« (Eph 2,21). Zusammengehalten werden und wachsen, das bedeutet, in Harmonie wachsen, und etwas in Harmonie wachsen lassen, das kann nur der Heilige Geist, wie es der heilige Basilius so schön formuliert hat: „Ipse harmonia est“, Nummer 38 des Traktats [„Über den Heiligen Geist“]. Um zu bestehen, braucht jede Konstruktion, so denke ich, solide Fundamente; deshalb möchte ich über die Haltungen sprechen, die der Person des Priesters Festigkeit verleihen; ich möchte sprechen über – ihr habt das schon gehört, aber ich wiederhole es noch einmal – die vier Grundpfeiler unseres priesterlichen Lebens, die wir „vier Arten von Nähe“ nennen wollen, weil sie dem Stil Gottes folgen, der im Letzen ein Stil der Nähe ist (vgl. Dtn 4,7). Er selbst definiert sich gegenüber dem Volk so: „Sagt mir, welchem Volk sind seine Götter so nahe wie ich euch?“. Gottes Stil ist Nähe, eine besondere Nähe, Mitgefühl und Zärtlichkeit. Diese drei Worte bestimmen das Leben eines Priesters und auch das eines Christen, denn sie entsprechen genau dem Stil Gottes: Nähe, Mitgefühl und Zärtlichkeit.
Auf diesen Zusammenhang habe ich bereits früher hingewiesen, aber heute möchte ich ausführlicher darauf eingehen, denn der Priester braucht keine Rezepte oder Theorien, sondern konkrete Werkzeuge, mit denen er seinen Dienst, seine Sendung und sein tägliches Leben angehen kann. Paulus ermahnt Timotheus, die Gabe Gottes, die ihm durch Handauflegung zuteilwurde, lebendig zu erhalten, und die nicht Geist der Verzagtheit, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit ist (vgl. 2 Tim 1,6-7). Ich glaube, dass diese vier Säulen, diese vier Arten der Nähe, über die ich jetzt sprechen werde, auf praktische, konkrete und hoffnungsvolle Weise dazu beitragen können, das Geschenk und die Fruchtbarkeit, die uns einst versprochen wurden, wieder zu beleben, dieses Geschenk am Leben zu erhalten.
Nähe zu Gott
Das heißt, die Nähe zum Herrn, der vielfach nahe ist. »Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben« – das ist die Stelle, wo das Johannesevangelium vom „bleiben“ spricht. »Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt: Ihr werdet es erhalten« (Joh 15,5-7).
Der Priester ist vor allem eingeladen, diese Nähe, diese Intimität mit Gott zu pflegen, und aus dieser Beziehung wird er all die nötige Kraft für seinen Dienst schöpfen können. Die Beziehung zu Gott ist gewissermaßen das Pfropfreis, das uns in einer fruchtbaren Verbindung hält. Ohne eine nennenswerte Beziehung zum Herrn wird unser Dienst ganz sicher steril werden. Die Nähe zu Jesus, der Kontakt mit seinem Wort, ermöglicht es uns, unser Leben mit dem seinem in Bezug zu setzen und zu lernen, an nichts, was uns widerfährt, Anstoß zu nehmen und uns vor den „Skandalen“ schützen. Wie der Herr selbst werdet auch Ihr Momente der Freude und der Hochzeit, der Wunder und der Heilungen, der Brotvermehrung und der Ruhe erleben. Es wird Zeiten geben, in denen man gelobt wird, aber es wird auch Zeiten der Undankbarkeit, der Ablehnung, des Zweifels und der Einsamkeit geben, bis zu dem Punkt, an dem man sagen muss: »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« (Mt 27,46).
Die Nähe zu Jesus kann uns die Angst vor diesen Momenten nehmen – nicht, weil wir stark sind, sondern weil wir auf ihn schauen, uns an ihm festhalten und zu ihm sagen: »Herr, lass mich nicht in Versuchung geraten! Lass mich verstehen, dass ich einen wichtigen Moment in meinem Leben erlebe und dass du mit mir bist, um meinen Glauben und meine Liebe zu prüfen« (C.M. Martini, Incontro al Signore Risorto, San Paolo, 102). Diese Nähe zu Gott nimmt manchmal die Form eines Kampfes an: eines Ringens mit dem Herrn, besonders in Zeiten, in denen seine Abwesenheit im Leben des Priesters oder im Leben der ihm anvertrauten Menschen am stärksten zu spüren ist. Die ganze Nacht kämpfen und um seinen Segen bitten (vgl. Gen 32,25-27), das wird für viele eine Quelle des Lebens sein. Manchmal ist es ein Kampf. Ein Priester, der hier in der Kurie arbeitet - er hat eine schwierige Aufgabe, nämlich für Ordnung an einem Ort zu sorgen, er ist jung, - er erzählte mir, dass er müde nach Hause kam, er kam müde nach Hause, aber er ruhte sich vor dem Schlafengehen mit dem Rosenkranz in der Hand vor dem Bild der Muttergottes aus. Er brauchte diese Nähe, ein Mitarbeiter in der Kurie, ein Angestellter des Vatikans. Es gibt viel Kritik an den Leuten in der Kurie, bisweilen zu Recht, aber ich kann auch sagen und bezeugen, dass es hier Heilige gibt, das ist wahr.
Viele Krisen im Leben eines Priesters haben ihren Ursprung gerade in einem unzureichenden Gebetsleben, in einem Mangel an Intimität mit dem Herrn, in einer Reduzierung des geistlichen Lebens auf bloß äußerliche religiöse Praxis. Das will auch bei der Ausbildung unterschieden werden: Geistliches Leben ist das eine, religiöse Praxis das andere. „Wie steht es um dein geistliches Leben?“ – „Gut, gut. Ich meditiere morgens, ich bete den Rosenkranz, ich bete die 'Schwiegermutter' – die Schwiegermutter ist das Brevier – ich bete das Brevier und all das ... ich mache alles.“ Nein, das ist religiöse Praxis. Aber wie steht es um dein geistliches Leben? Ich erinnere mich an wichtige Momente in meinem Leben, wo die Nähe zum Herrn entscheidend dazu beitrug, dass ich mich auf den Beinen halten konnte, in dunklen Zeiten. Ohne die Intimität des Gebets, des geistlichen Lebens, der konkreten Nähe zu Gott durch das Hören des Wortes, die Feier der Eucharistie, die Stille der Anbetung, das Sich-Anvertrauen an Maria, die weise Begleitung durch einen Seelenführer, das Sakrament der Versöhnung, ohne diese konkreten Arten der Nähe ist ein Priester sozusagen nur ein müder Arbeiter, der nicht in den Genuss der Wohltaten für die Freunde des Herrn kommt. In der anderen Diözese habe ich die Priester gerne gefragt: „Und erzähl mir – sie erzählten mir von ihren Tätigkeiten – erzähl mir, wie gehst du ins Bett?“. Und sie haben das nicht verstanden. „Ja, ja, wie gehst du denn abends ins Bett?“ – „Ich komme müde nach Hause, esse einen Happen und gehe ins Bett, und vor dem Bett läuft der Fernseher...“ – „Ah, gut! Und schaust du nicht kurz beim Herrn vorbei, um ihm wenigstens gute Nacht zu sagen?“ Das ist das Problem. Mangel an Nähe. Es ist normal, müde von der Arbeit zu sein und sich auszuruhen und fernzusehen, das ist legitim, aber ohne den Herrn, ohne diese Nähe. Er hatte den Rosenkranz gebetet, er hatte das Brevier gebetet, aber ohne Vertrautheit mit dem Herrn. Er hatte nicht das Bedürfnis, dem Herrn zu sagen: „Ciao, bis morgen, vielen Dank!“ Es sind kleine Gesten, die die Haltung einer priesterlichen Seele offenbaren. Allzu oft wird zum Beispiel im priesterlichen Leben das Gebet als reine Pflichterfüllung gesehen, wobei vergessen wird, dass Freundschaft und Liebe nicht als äußere Regel auferlegt werden können, sondern eine grundlegende Entscheidung unseres Herzens sind. Ein Priester, der betet, bleibt ein Christ von der Wurzel her, der die in der Taufe empfangene Gabe voll verstanden hat. Ein Priester, der betet, ist ein Sohn, der sich ständig daran erinnert, dass er ein Sohn ist und dass er einen Vater hat, der ihn liebt. Ein Priester, der betet, ist ein Sohn, der sich in die Nähe des Herrn begibt.
Aber all das ist schwierig, wenn man keine festen Zeiten der Stille in den Tagesablauf integriert hat, wenn man nicht weiß, wie man die „Aktivität“ Marthas ablegen kann, um das „Dasein“ Marias zu lernen. Es ist schwierig, dem Aktivismus abzuschwören – oft ist der Aktivismus eine Flucht –, denn wenn man aufhört, sich mit etwas zu beschäftigen, kommt nicht sofort Friede in das Herz, sondern Melancholie; und um nicht in Melancholie zu geraten, ist man bereit, niemals innezuhalten. Da ist die Arbeit eine Ablenkung, um nicht in Melancholie zu geraten. Aber diese Trostlosigkeit ist ein bisschen der Punkt der Begegnung mit dem Herrn. Gerade wenn man die Melancholie annimmt, die der Stille entspringt, aus dem Verzicht auf Aktivität und viele Worte, aus dem Mut, sich aufrichtig zu prüfen, gerade dann erscheint alles in einem Licht und einem Frieden, der nicht mehr auf unseren eigenen Kräften und Fähigkeiten beruht. Es geht darum, zu lernen, den Herrn weiter in jeder Person wirken zu lassen und alles zu beschneiden, was unproduktiv und unfruchtbar ist und die Berufung verzerrt. Ausharren im Gebet bedeutet nicht nur, einer Praxis treu zu bleiben: Es bedeutet, nicht wegzulaufen, wenn eben das Gebet uns in die Wüste führt. Der Weg durch die Wüste ist der Weg, der zur Vertrautheit mit Gott führt, allerdings unter der Bedingung, dass wir nicht weglaufen, dass wir keine Wege finden, dieser Begegnung zu entkommen. In der Wüste „will ich ihm zu Herzen reden“, sagt der Herr über sein Volk durch den Propheten Hosea (vgl. 2,16).Das ist eine Frage, die sich der Priester stellen muss: ob er in der Lage ist, sich in die Wüste führen zu lassen. Die Seelenführer, die die Priester begleiten, müssen verstehen, müssen ihnen helfen und ihnen diese Frage stellen: Bist du fähig, dich in die Wüste zu begeben? Oder gehst du direkt in die Oase des Fernsehens oder sonst wohin?
Die Nähe zu Gott ermöglicht es dem Priester, mit dem Schmerz in unserem Herzen in Kontakt zu treten, der, wenn er angenommen wird, uns so weit entwaffnet, dass eine Begegnung möglich wird. Das Gebet, das wie ein Feuer das priesterliche Leben beseelt, ist der Schrei eines zerbrochenen und zerschlagenen Herzens, das – so sagt uns das Wort Gottes – der Herr nicht verschmäht (vgl. Ps 51,19). »Die aufschrien hat der Herr erhört, er hat sie all ihren Nöten entrissen. Nahe ist der Herr den zerbrochenen Herzen, und dem zerschlagenen Geist bringt er Hilfe« (Ps 34,18-19).
Ein Priester braucht ein Herz, das genügend Weite besitzt, um dem Schmerz der ihm anvertrauten Menschen Raum zu geben und gleichzeitig als Wächter die Morgenröte der Gnade Gottes anzukündigen, die sich gerade in diesem Schmerz zeigt. In der Gegenwart des Herrn das eigene Elend zu umarmen, anzunehmen und ihm darzubringen, wird gewiss die beste Schule sein, um nach und nach all dem Elend und dem Schmerz, denen er in seinem Dienst täglich begegnen wird, immer mehr Raum zu geben, bis er dem Herzen Christi gleicht. Und das bereitet den Priester auch auf eine andere Nähe vor: die zum Volk Gottes. In seiner Nähe zu Gott verstärkt der Priester die Nähe zu seinem Volk; und umgekehrt lebt er in der Nähe zu seinem Volk auch die Nähe zu seinem Herrn. Und diese Nähe zu Gott – das fällt mir auf – ist die erste Aufgabe der Bischöfe, denn als die Apostel die Diakone „erfinden“, da erklärt Petrus ihre Funktion und sagt: „Und uns – den Bischöfen – obliegt das Gebet und die Verkündigung des Wortes“ (vgl. Apg 6,4). Mit anderen Worten: Die erste Aufgabe des Bischofs ist das Gebet; und auch der Priester hat diese Aufgabe: zu beten.
Johannes der Täufer sagte: »Er muss wachsen, ich aber geringer werden« (Joh 3,30). Die Intimität mit Gott macht all dies möglich, denn im Gebet erfährt man, dass man in seinen Augen groß ist, und dann ist es für die Priester, die dem Herrn nahestehen, kein Problem mehr, in den Augen der Welt klein zu werden. Und dort, in dieser Nähe, ist es nicht mehr beängstigend, dem gekreuzigten Jesus ähnlich zu werden, so wie es im Ritus der Priesterweihe von uns verlangt wird. Das ist etwas sehr Schönes, aber oft vergessen wir es.
Kommen wir nun zur zweiten Nähe, die etwas kürzer sein wird als die erste.
Nähe zum Bischof
Diese zweite Nähe wurde lange Zeit nur einseitig wahrgenommen. Als Kirche haben wir allzu oft, auch heute noch, den Gehorsam nicht dem Evangelium entsprechend interpretiert. Der Gehorsam ist keine disziplinäre Beifügung, sondern das stärkste Wesensmerkmal der Bande, die uns als Gemeinschaft vereinen. Gehorchen, in diesem Fall dem Bischof, bedeutet zu lernen, zuzuhören und sich daran zu erinnern, dass niemand den Anspruch erheben kann, den Willen Gottes zu kennen, und dass dieser nur durch Unterscheidung verstanden werden kann. Gehorsam ist also das Hören auf den Willen Gottes, der nur in einer festen Beziehung erkannt werden kann. Eine solche Haltung des Zuhörens ermöglicht es, die Idee zu entwickeln, dass niemand das Prinzip und Fundament des Lebens ist, sondern dass jeder notwendigerweise mit den anderen in Beziehung stehen muss. Diese Logik der Nähe – in diesem Fall zum Bischof, aber das gilt auch für die anderen Arten der Nähe – ermöglicht es, aller Versuchung zu widerstehen, sich zu verschließen, sich selbst zu rechtfertigen und ein Leben „als Junggeselle“, oder gar als „eingefleischter Junggeselle“ zu führen. Wenn Priester sich verschließen … dann enden sie als „eingefleischte Junggesellen“ mit allen Junggesellen-Manien und das ist nicht schön. Diese Nähe lädt im Gegenteil dazu ein, sich an andere Instanzen zu wenden, um den Weg zu finden, der zur Wahrheit und zum Leben führt.
Der Bischof ist kein Schulaufseher, er ist kein Aufpasser, er ist ein Vater, und er sollte diese Nähe geben. Der Bischof muss versuchen, sich so zu verhalten, da er sonst die Priester entfremdet oder nur die ehrgeizigen unter ihnen anzieht. Der Bischof, wer auch immer er sein mag, bleibt für jeden Priester und für jede Teilkirche ein Bindeglied, das hilft, den Willen Gottes zu erkennen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Bischof selbst nur dann ein Werkzeug dieser Unterscheidung sein kann, wenn auch er auf die Wirklichkeit seiner Priester und des ihm anvertrauten heiligen Gottesvolkes hört. In Evangelii gaudium habe ich geschrieben: »Wir müssen uns in der Kunst des Zuhörens üben, die mehr ist als Hören. In der Verständigung mit den anderen steht an erster Stelle die Fähigkeit des Herzens, welche die Nähe möglich macht, ohne die es keine wahre geistliche Begegnung geben kann. Zuhören hilft uns, die passende Geste und das passende Wort zu finden, die uns aus der bequemen Position des Zuschauers herausholen. Nur auf der Grundlage dieses achtungsvollen, mitfühlenden Zuhörens ist es möglich, die Wege für ein echtes Wachstum zu finden, das Verlangen nach dem christlichen Ideal und die Sehnsucht zu wecken, voll auf die Liebe Gottes zu antworten und das Beste, das Gott im eigenen Leben ausgesät hat, zu entfalten« (Nr. 171).
Es ist kein Zufall, dass das Böse, um die Fruchtbarkeit des kirchlichen Handelns zu zerstören, versucht, die Bande, die uns zusammenhalten, zu untergraben. Es gilt, die Bindung des Priesters an die Teilkirche, das Institut, dem er angehört, und an den Bischof zu verteidigen, und dies macht das priesterliche Leben verlässlich. Die Bindungen bewahren. Der Gehorsam ist die grundlegende Entscheidung, diejenigen anzunehmen, die als konkretes Zeichen des universalen Heilssakraments, das die Kirche ist, unsere Vorgesetzten sind. Gehorsam, der auch Konfrontation, Zuhören und in manchen Fällen auch Spannung bedeuten kann, ohne dass es jedoch zum Bruch kommt. Dies erfordert von den Priestern, für die Bischöfe zu beten und ihre Meinung respektvoll, mutig und aufrichtig zu äußern. Das verlangt auch von den Bischöfen Demut, die Fähigkeit zuzuhören, selbstkritisch zu sein und sich helfen zu lassen. Wenn wir diese Verbindung bewahren, werden wir auf unseren Weg sicher vorankommen.
Und ich glaube, das genügt, was die Nähe zu den Bischöfen betrifft.
Nähe der Priester untereinander
Das ist die dritte Art der Nähe. Nähe zu Gott, Nähe zu den Bischöfen, Nähe zu den anderen Priestern. Eben aus dieser Gemeinschaft mit dem Bischof ergibt sich die dritte Art von Nähe, nämlich die der brüderlichen Gemeinschaft. Jesus offenbart sich dort, wo es Brüder gibt, die bereit sind, einander zu lieben: »Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen« (Mt 18,20). Wie der Gehorsam, so kann auch die Brüderlichkeit nicht als eine von außen auferlegte moralische Verpflichtung verstanden werden. Brüderlichkeit bedeutet, sich bewusst dafür zu entscheiden, mit anderen und nicht in Einsamkeit den Weg der Heiligkeit zu gehen. Heilig mit anderen. Ein afrikanisches Sprichwort, das ihr gut kennt, sagt: „Wenn du schnell gehen willst, geh allein; wenn du weit gehen willst, geh mit anderen“. Manchmal hat man den Eindruck, dass die Kirche langsam ist – und das stimmt auch –, aber mir gefällt der Gedanke, dass es sich dabei um die Langsamkeit derer handelt, die sich entschieden haben, in brüderlicher Gemeinschaft zu gehen. Auch die Geringsten zu begleiten, aber immer auf geschwisterliche Weise.
Die Merkmale der Geschwisterlichkeit sind die der Liebe. Der heilige Paulus hat uns im Ersten Brief an die Korinther (Kapitel 13) eine klare „Landkarte“ der Liebe hinterlassen und in gewissem Sinne aufgezeigt, worauf die Brüderlichkeit abzielen sollte. Erstens geht es darum, Geduld zu erlernen, d.h. die Fähigkeit, sich für andere verantwortlich zu fühlen, ihre Lasten zu tragen, in gewissem Sinne mit ihnen zu leiden. Das Gegenteil von Geduld ist Gleichgültigkeit, die Distanz, die wir zu anderen aufbauen, um ihr Leben nicht an uns heranzulassen. Viele Priester erleben eine schlimme Einsamkeit, das Gefühl des Alleinseins. Sie meinen, der Geduld und der Rücksicht anderer nicht würdig zu sein. Im Gegenteil, es scheint ihnen, dass von anderen nur Urteile kommen und nicht das Gute, nicht die Güte. Der andere ist unfähig, sich über das Gute zu freuen, das uns im Leben widerfährt, oder auch ich bin unfähig dazu, wenn ich das Gute im Leben der anderen sehe. Diese Unfähigkeit, sich über das Wohlergehen anderer, der anderen, zu freuen, ist der Neid, der unsere Lebenswelten so sehr heimsucht und für die Pädagogik der Liebe ein Kampf ist, nicht einfach eine Sünde, die man beichten muss. Die Sünde ist das Letzte, es ist die Einstellung, die neidisch ist. Der Neid ist in priesterlichen Gemeinschaften sehr präsent. Und das Wort Gottes sagt uns, dass dies eine zerstörerische Haltung ist: Durch den Neid des Teufels ist die Sünde in die Welt gekommen (vgl. Weish 2,24). Der Neid ist die Tür, die Tür zur Zerstörung. Und da müssen wir ganz klar sagen, in unseren Priestern gibt es Neid. Nicht jeder ist neidisch, nein, aber die Versuchung des Neides ist groß. Wir sollten vorsichtig sein. Und aus Neid kommt das Gerede.
Um sich der Gemeinschaft zugehörig zu fühlen, um ein „Wir-Gefühl“ zu entwickeln, brauchen wir nicht Masken zu tragen, die ein rein positives Bild von uns vermitteln. Das heißt, wir müssen nicht prahlen, wir müssen uns nicht aufblähen oder, noch schlimmer, verletzend werden und dürfen uns unseren Mitmenschen gegenüber nicht ungehörig verhalten. Es gibt auch klerikale Formen von bullying. Denn wenn ein Priester etwas hat, dessen er sich rühmen kann, dann ist das die Barmherzigkeit des Herrn; er kennt seine eigene Sünde, sein eigenes Elend und seine eigene Begrenztheit, aber er hat erfahren, dass dort, wo die Sünde mächtig wurde, die Liebe übergroß wurde (vgl. Röm 5,20); und das ist schon seine erste frohe Botschaft. Ein Priester, der das präsent hat, ist nicht neidisch, er kann nicht neidisch sein.
Die brüderliche Liebe sucht nicht das Eigeninteresse, sie lässt keinen Raum für Zorn, für Groll, als ob mein Bruder mich irgendwie um irgendetwas betrogen hätte. Und wenn ich dem Elend des anderen begegne, bin ich bereit, das Böse nicht nachzutragen, es nicht zum einzigen Kriterium der Beurteilung zu machen oder gar mich über die Ungerechtigkeit zu freuen, wenn sie eben die Person betrifft, die mich leiden ließ. Wahre Liebe freut sich an der Wahrheit und hält es für eine schwere Sünde, die Wahrheit und die Würde der Brüder und Schwestern durch Verleumdung, Verunglimpfung und Klatsch anzugreifen. Der Ursprung ist der Neid. Dazu kommt es, sogar zu Verleumdungen, um eine Position zu erreichen... Und das ist sehr traurig. Wenn von hier aus Informationen angefordert werden, um jemanden zum Bischof zu machen, erhalten wir oft Informationen, die krank sind vor Neid. Und das ist eine Krankheit unserer Priester. Viele von euch sind Ausbilder in den Seminaren, bedenkt dies.
In diesem Sinne darf die brüderliche Liebe jedoch nicht als Utopie betrachtet werden, geschweige denn als „Gemeinplatz“, wo beschauliche Reden mit schönen Gefühlen oder gemessenen Worten gehalten werden. Nein. Wir alle wissen, wie schwierig es sein kann, in einer Gemeinschaft oder in der Gemeinschaft mit den anderen Priestern zu leben – irgendein Heiliger hat einmal gesagt: das Gemeinschaftsleben ist meine Bußübung –, wie schwer ist es doch, das tägliche Leben mit denen zu teilen, die wir als Brüder anerkennen wollen. Die brüderliche Liebe ist, wenn wir sie nicht beschönigen, anpassen oder verharmlosen wollen, die „große Prophetie“, zu der wir in unserer Wegewerfgesellschaft gerufen sind. Ich stelle mir die brüderliche Liebe gerne als ein Fitness-Studio des Geistes vor, wo wir uns Tag für Tag mit uns selbst messen und ein Thermometer für unser geistliches Leben haben. Heute bleibt die Prophetie der Brüderlichkeit lebendig und sie braucht Verkünder; sie braucht Menschen, die sich im Bewusstsein ihrer eigenen Grenzen und der auftretenden Schwierigkeiten von den Worten des Herrn berühren, herausfordern und bewegen lassen: »Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt« (Joh 13,35).
Für die Priester bleibt die brüderliche Liebe nicht auf eine kleine Gruppe beschränkt, sondern findet ihren weiteren Ausdruck in der pastoralen Liebe (vgl. Nachsynodales Apostolisches Schreiben Pastores Dabo Vobis, 23), die uns ermutigt, sie in unserer jeweiligen Aufgabe konkret zu leben. Wir können sagen, dass wir lieben, wenn wir lernen, dieser Liebe, wie von Paulus beschrieben, Ausdruck zu verleihen. Und nur die, die zu lieben suchen, gehen den sicheren Weg. Diejenigen, die mit dem Kain-Syndrom leben, in der Überzeugung, nicht lieben zu können, weil sie immer das Gefühl haben, selbst nicht geliebt und nicht wertgeschätzt zu werden, nicht die richtige Anerkennung zu erfahren, leben letztlich immer wie Vagabunden, die sich nirgends zu Hause fühlen und gerade deshalb dem Bösen stärker ausgesetzt sind: der Gefahr, sich selbst und anderen zu schaden. Deswegen hat die Liebe unter den Priestern eine beschützende Funktion, sich gegenseitig zu behüten.
Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass dort, wo die priesterliche Brüderlichkeit funktioniert, die Nähe der Priester untereinander, wo echte Bande der Freundschaft bestehen, es auch möglich ist, die Entscheidung für den Zölibat mit größerer Gelassenheit zu leben. Der Zölibat ist ein Geschenk, das die lateinische Kirche bewahrt, aber es ist ein Geschenk, das, wenn es als Weg der Heiligung gelebt werden soll, gesunde Beziehungen braucht, Beziehungen, die von echtem Wohlwollen und echter Güte geprägt sind und die in Christus wurzeln. Ohne Freunde und ohne Gebet kann der Zölibat zu einer unerträglichen Last werden und die Schönheit des Priesterseins entstellen.
Jetzt kommen wir zur vierten Art von Nähe, der letzten, nämlich der Nähe zum Volk Gottes, zum heiligen und gläubigen Volk Gottes. Es wäre gut, Lumen gentium zu lesen, Nummer 8 und Nummer 12.
Nähe zu den Menschen
Schon oft habe ich betont, dass die Beziehung zu Gottes heiligem Volk für jeden von uns nicht eine Pflicht, sondern eine Gnade ist. »Die Liebe zu den Menschen ist eine geistliche Kraft, welche die volle Begegnung mit Gott erleichtert« (Evangelii gaudium, 272). Deshalb ist der Platz eines jeden Priesters inmitten des Volkes, in einer Beziehung der Nähe zum Volk.
In Evangelii gaudium habe ich darauf hingewiesen, dass wir, um Verkünder des Evangeliums zu sein, auch ein geistliches Wohlgefallen daran finden müssen, »nahe am Leben der Menschen zu sein, bis zu dem Punkt, dass man entdeckt, dass dies eine Quelle höherer Freude ist. Die Mission ist eine Leidenschaft für Jesus, zugleich aber eine Leidenschaft für sein Volk. Wenn wir vor dem gekreuzigten Jesus verweilen, erkennen wir all seine Liebe, die uns Würde verleiht und uns trägt; wenn wir aber nicht blind sind, beginnen wir zugleich wahrzunehmen, dass dieser Blick Jesu sich weitet und sich voller Liebe und innerer Glut auf sein ganzes gläubiges Volk richtet. So entdecken wir wieder neu, dass er uns als Werkzeug nehmen will, um seinem geliebten Volk immer näher zu kommen. Jesus möchte sich der Priester bedienen, um dem heiligen und gläubigen Volk Gottes näher zu kommen. Er nimmt uns aus der Mitte des Volkes und sendet uns zum Volk, sodass unsere Identität nicht ohne diese Zugehörigkeit verstanden werden kann« (ebd., 268). Die priesterliche Identität ist ohne Zugehörigkeit zum heiligen und gläubigen Volk Gottes nicht denkbar.
Ich bin mir sicher, dass es, um die Identität des Priestertums neu zu verstehen, heute wichtig ist, in engem Bezug zum realen Leben der Menschen zu leben, an ihrer Seite, ohne Fluchtwege. »Zuweilen verspüren wir die Versuchung, Christen zu sein, die einen sicheren Abstand zu den Wundmalen des Herrn halten. Jesus aber will, dass wir mit dem menschlichen Elend in Berührung kommen, dass wir mit dem leidenden Leib der anderen in Berührung kommen. Er hofft, dass wir darauf verzichten, unsere persönlichen oder gemeinschaftlichen Zuflüchte zu suchen, die uns erlauben, gegenüber dem Kern des menschlichen Leids auf Distanz zu bleiben, damit wir dann akzeptieren, mit dem konkreten Leben der anderen ernsthaft in Berührung zu kommen und die Kraft der Zartheit kennen lernen. Wenn wir das tun, wird das Leben für uns wunderbar komplex, und wir machen die tiefe Erfahrung, Volk zu sein, die Erfahrung, zu einem Volk zu gehören« (ebd., 270). Und das Volk ist keine logische Kategorie, nein, es ist eine mythische Kategorie; um es zu verstehen, müssen wir uns ihm annähern, wie man sich einer mythischen Kategorie annähert.
Die Nähe zum Volk Gottes. Eine Nähe, die, bereichert durch die anderen Arten von Nähe, die anderen drei Arten, dazu einlädt – und es in gewisser Weise verlangt –, den Stil des Herrn weiterzuführen, der ein Stil der Nähe, des Mitgefühls und der Zärtlichkeit ist, weil er in der Lage ist, nicht wie ein Richter, sondern wie der barmherzige Samariter zu handeln, der die Wunden seines Volkes kennt, das im Stillen erfahrene Leid, die Entsagungen und Opfer, die viele Väter und Mütter auf sich nehmen, um ihren Familien ein Fortkommen zu ermöglichen, aber auch die Folgen von Gewalt, Korruption und Gleichgültigkeit, die jede Hoffnung zu ersticken drohen. Eine Nähe, die es ermöglicht, die Wunden zu salben und ein Gnadenjahr des Herrn zu verkünden (vgl. Jes 61,2). Es ist entscheidend, sich daran zu erinnern, dass das Volk Gottes darauf hofft, Hirten nach dem Vorbild Jesu zu finden – und nicht Kleriker mit Standesdünkel – denken wir an diese Epoche in Frankreich: da gab es den Pfarrer von Ars, den Kuraten, aber da gab es auch den „monsieur l‘abbé“, Kleriker mit Standesdünkel. Auch heute möchten die Menschen Hirten des Volkes und nicht Kleriker mit Standesdünkel oder „Sakral-Profis“; Hirten, die mitfühlen können und Chancen erkennen; mutige Menschen, die fähig sind, bei den Verwundeten stehenzubleiben und ihnen die Hand zu reichen; kontemplative Menschen, die in ihrer Nähe zu den Menschen angesichts der Wunden dieser Welt die Kraft der Auferstehung verkünden.
Eines der entscheidenden Merkmale unserer digitalen „Netzwerk“-Gesellschaft ist, dass das Gefühl des Verwaistseins weit verbreitet ist. Dies ist ein aktuelles Phänomen. Wir sind mit allem und jedem verbunden, aber es fehlt uns die Erfahrung der Zugehörigkeit, die viel mehr ist als eine Verbindung. Durch die Nähe des Hirten kann man eine Gemeinschaft versammeln und das Wachsen eines Gefühls der Zugehörigkeit fördern; wir gehören zum heiligen, gläubigen Volk Gottes, das dazu berufen ist, ein Zeichen des Anbruchs des Reiches Gottes in der Gegenwart der Geschichte zu sein. Wenn der Hirte in die Irre geht, sich entfernt, werden sich auch die Schafe zerstreuen und für jeden Wolf eine leichte Beute sein.
Diese Zugehörigkeit wiederum ist das Gegenmittel gegen eine Entstellung der Berufung, die daher rührt, dass man vergisst, dass das priesterliche Leben den anderen geschuldet ist – dem Herrn und den von ihm anvertrauten Menschen. Dieses Vergessen ist die Wurzel des Klerikalismus – von dem Kardinal Ouellet gesprochen hat – mit all seinen Folgen. Der Klerikalismus ist eine Perversion, ebenso wie eines seiner Anzeichen, die Starrheit. Der Klerikalismus ist eine Perversion, weil er auf „Distanz“ beruht. Das ist kurios: er beruht nicht auf Nähe, sondern auf dem Gegenteil. Wenn ich an den Klerikalismus denke, denke ich auch an die Klerikalisierung der Laien: die Förderung einer kleinen Elite, die um den Priester herum auch die eigene grundlegende Sendung verfälscht (vgl. Gaudium et spes, 44), die Sendung des Laien. Es gibt viele klerikalisierte Laien, viele: „Ich gehöre zu dieser Vereinigung, wir sind dort in dieser Pfarrei, wir sind…“. Die „Auserwählten“, klerikalisierte Laien, das ist eine ganz schöne Versuchung. Erinnern wir uns daran: »Die Mission im Herzen des Volkes ist nicht ein Teil meines Lebens, oder ein Schmuck, den ich auch wegnehmen kann; sie ist kein Anhang oder ein zusätzlicher Belang des Lebens. Sie ist etwas, das ich nicht aus meinem Priestersein ausreißen kann, außer ich will mich zerstören. Ich bin eine Mission auf dieser Erde, und ihretwegen bin ich auf dieser Welt. Man muss erkennen, dass man selber ›gebrandmarkt‹ ist für diese Mission, Licht zu bringen, zu segnen, zu beleben, aufzurichten, zu heilen, zu befreien« (Evangelii Gaudium, 273).
Ich möchte diese Nähe zum Volk Gottes mit der Nähe zu Gott in Verbindung sehen, denn das Gebet des Hirten wird im Herzen des Volkes Gottes genährt und verkörpert. Wenn er betet, trägt der Hirte die Zeichen der Wunden und Freuden seines Volkes, die er in aller Stille dem Herrn vorlegt, damit er sie mit der Gabe des Heiligen Geistes salbe. Es ist die Hoffnung des Hirten, der darauf vertraut und dafür kämpft, dass der Herr sein Volk segne.
In Anlehnung an die Lehre des heiligen Ignatius, dass nicht das viele Wissen die Seele befriedigt und sättigt, sondern das Innerlich-die-Dinge-Verspüren-und-Schmecken (vgl. Exerzitien, Anmerkungen, 2, 4), ist es für Bischöfe und Priester gut, sich zu fragen: „Wie geht es mir mit diesen Arten der Nähe?“, wie lebe ich diese vier Dimensionen, die mein priesterliches Sein durchgängig prägen und mir erlauben, mit den Spannungen und Ungleichgewichten umzugehen, mit denen wir täglich zu tun haben. Diese vier Dimensionen der Nähe sind eine gute Schule für das „Spiel auf offenem Feld“, zu dem der Priester gerufen ist, ohne Angst, ohne Starrheit, ohne Einschränkung oder Verarmung der Mission. Ein priesterliches Herz weiß um die Nähe, denn der Erste, der Nähe schenken wollte, war der Herr. Er möge im Gebet zu seinen Priestern kommen, im Bischof, in den Mitbrüdern im Priesteramt und in seinem Volk. Er möge die Routine unterbrechen und ein wenig stören und Unruhe stiften – wie in der Zeit der ersten Liebe –, er möge alle Fähigkeiten in Bewegung setzen, damit unser Volk das Leben hat und es in Fülle hat (vgl. Joh 10,10). Die verschiedenen Dimensionen der Nähe des Herrn sind keine zusätzliche Aufgabe: Sie sind ein Geschenk, das er macht, um die Berufung lebendig und fruchtbar zu erhalten. Die Nähe zu Gott, die Nähe zum Bischof, die Nähe unter uns Priestern und die Nähe zum Heiligen und gläubigen Volk Gottes.
Angesichts der Versuchung, uns in endlosen Diskursen und Diskussionen über die Theologie des Priestertums oder über Theorien darüber, was es sein sollte, zu verschließen, schaut uns der Herr mit Zärtlichkeit und Mitgefühl an und bietet den Priestern die Koordinaten an, von denen aus sie ihre Aufgabe erkennen und den Eifer für ihre Sendung lebendig halten können: Nähe, die mitfühlend und zärtlich ist, Nähe zu Gott, zum Bischof, zu den Mitbrüdern und zu den ihnen anvertrauten Menschen. Nähe nach dem Vorbild Gottes, der mit Mitgefühl und Zärtlichkeit nahe ist.
Ich danke euch für eure Nähe und eure Geduld, danke, danke vielmals! Ich wünsche euch für eure Arbeit alles Gute. Ich gehe jetzt in die Bibliothek, weil ich heute Vormittag viele Termine habe. Betet für mich, ich werde auch für euch beten. Frohes Schaffen!
[Segen]
Copyright © Dikasterium für Kommunikation