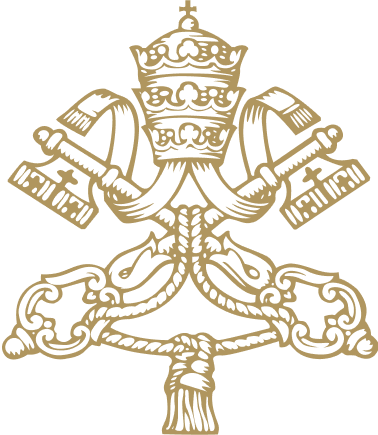ANSPRACHE VON PAPST FRANZISKUS
AN DIE TEILNEHMER AN DER VOLLVERSAMMLUNG DES
DIKASTERIUMS FÜR DIE KULTUR UND DIE BILDUNG
Sala Clementina
Donnerstag, 21. November 2024
______________________________________
Lieber Kardinal und Präfekt,
liebe leitende Mitarbeiter,
Eminenzen, Exzellenzen,
liebe Brüder und Schwestern!
Ich empfange euch, während ihr die erste Vollversammlung des Dikasteriums für die Kultur und die Bildung abhaltet. Und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um die Bedeutung des Risikos zu unterstreichen, diese beiden zu kombinieren: Kultur und Bildung.
Als ich beschlossen habe, mit der Apostolischen Konstitution Praedicate Evangelium diese beiden Behörden des Heiligen Stuhls, die sich mit der Bildung beziehungsweise der Kultur befassten, zu vereinen, hat mich dazu nicht so sehr das Bemühen um ökonomische Rationalisierung geleitet, sondern vielmehr der Ausblick auf die Möglichkeiten des Dialogs, der Synergie und der Innovation, die diese beiden Bereiche noch fruchtbarer, ja ich würde sagen »überfließender« machen können.
Die Welt braucht keine schlafwandlerischen Wiederholer dessen, was es bereits gibt. Sie braucht neue Choreografen, neue Interpreten der Ressourcen, die der Mensch in sich trägt, neue Sozialpoeten. Denn wir brauchen keine Bildungsmodelle, die bloße »Erfolgsfabriken« sind, ohne ein kulturelles Projekt, das die Ausbildung von Personen ermöglicht, die in der Lage sind, der Welt dabei zu helfen, das Blatt zu wenden durch die Beseitigung von Ungleichheit, endemischer Armut und Exklusion. Die Pathologien der heutigen Welt sind kein Schicksal, dass wir passiv – und noch weniger aus Bequemlichkeit – zu akzeptieren hätten. Schulen, Universitäten, Kulturzentren sollten lehren, weiterhin durstig zu bleiben, Träume zu haben, denn wir »erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt«, wie es im Zweiten Petrusbrief (3,13) heißt.
Das sollte das Grundkriterium der Unterscheidung und der Umkehr für unsere Praxis in Kultur und Bildung werden: die Qualität der Erwartungen. Die Schlüsselfrage für unsere Institutionen lautet: »Was erwarten wir wirklich?« Vielleicht mag die ehrliche Antwort enttäuschend ausfallen: Erfolg in den Augen der Welt, die Ehre, auf der Rangliste oben zu stehen, oder die Selbsterhaltung. Wäre dem so, dann wäre das sicherlich zu wenig!
Brüder und Schwestern, die Erfahrung, die Gott uns ermöglicht, ist eine ganz andere. Ich erinnere an das, was Emily Dickinson in einem ihrer Gedichte schreibt:
»Als bäte ich um ein gewöhnliches Almosen,
Und in meine erstaunte Hand
Presste ein Unbekannter ein Königreich,
Und, ganz verwirrt, stünde ich da –
Als fragte ich den Orient,
Ob er eine Zukunft für mich hätte –
Und er würde seine
purpurnen Dämme heben
Und mich mit Morgenrot berauschen!«
»Sich mit Morgenrot berauschen«, ein schönes Bild, um diesen Prozess zu verdeutlichen. Auch ich fordere euch auf: Versteht eure Sendung im Bereich von Bildung und Kultur als einen Ruf, den Horizont zu erweitern, von innerer Lebendigkeit überzufließen, Raum zu schaffen für unerhörte Möglichkeiten, die Art und Weise des Schenkens zu erweitern – des Geschenks, das sich nur dann vermehrt, wenn es geteilt wird. Wir haben die Pflicht, dem Lehrer und dem Künstler zu sagen: »Seid freigiebig, riskiert etwas!«
Wir haben keinen Grund, uns von der Angst überwältigen zu lassen. Erstens weil Christus uns führt und unser Weggefährte ist. Zweitens weil wir die Hüter eines Erbes an Kultur und Bildung sind, das größer ist als wir selbst. Wir sind Erben des Tiefgangs von Augustinus. Wir sind Erben der Poesie des heiligen Ephrem, des Syrers. Wir sind Erben der Kathedralschulen und derer, die die Universität erfunden haben. Von Thomas von Aquin und Edith Stein. Wir sind Erben eines Volkes, das die Werke von Fra Angelico und Mozart in Auftrag gegeben hat, oder in jüngerer Zeit von Mark Rothko und Olivier Messiaen. Wir sind Erben der Künstler und Künstlerinnen, die sich von den Geheimnissen Christi haben inspirieren lasse. Wir sind Erben von klugen Wissenschaftlern wie Blaise Pascal. Mit einem Wort: Wir sind Erben der Leidenschaft für Kultur und Bildung von so vielen heiligen Männern und Frauen.
Umgeben von einer so großen Schar von Zeugen wollen wir die Bürde des Pessimismus ablegen. Pessimismus ist nicht christlich. Wir wollen mit all unseren Kräften gemeinsam arbeiten, um den Menschen aus dem Schatten des Nihilismus zu ziehen, der vielleicht die gefährlichste Geißel der heutigen Kultur ist, denn er maßt sich an, die Hoffnung auszulöschen. Und vergessen wir nicht: Die Hoffnung enttäuscht nicht, sie ist Kraft. Jenes Bild des Ankers: die Hoffnung enttäuscht nicht.
Vielleicht kann ich ein Geheimnis mit euch teilen: Zuweilen spüre ich den Wunsch, dieser Epoche der Geschichte ins Ohr zu rufen: »Vergiss die Hoffnung nicht!« Manchmal ist da der Mythos von Turandot: zu denken, dass die Hoffnung immer enttäuscht. Ich zähle auf euch, damit das nunmehr unmittelbar bevorstehende Heilige Jahr jenen Ruf verstärken kann. Es gibt so viel zu tun: Jetzt ist der Moment gekommen, die Ärmel hochzukrempeln.
Heute hat die Welt die höchste Anzahl von Schülern und Studenten in der Geschichte. Die Zahlen sind ermutigend: Rund 110 Millionen Kinder schließen die Grundschule ab. Dennoch bestehen weiterhin traurige Ungleichheiten. Etwa 250 Millionen Kinder und Jugendliche gehen nicht zur Schule. Es ist ein moralisches Gebot, diese Situation zu ändern. Denn kulturelle Völkermorde geschehen nicht nur durch die Zerstörung des kulturellen Erbes. Brüder und Schwestern, es ist kultureller Völkermord, wenn wir den Kindern die Zukunft stehlen, wenn wir ihnen nicht die Voraussetzungen bieten, das zu werden, was sie sein könnten. Wenn wir sehen, dass in so vielen Teilen der Welt Kinder im Müll nach Dingen suchen, die sie verkaufen können, um etwas zu essen zu haben. Denken wir an die Zukunft der Menschheit mit diesen Kindern.
In seinem Buch Die Erde des Menschen geht Antoine de Saint-Exupéry in einem Zug voller Flüchtlingsfamilien durch die Waggons dritter Klasse. Er hält sich dort auf, um sie zu beobachten. Er schreibt: Mich bedrückt »eine Art Wunde. […] Mich bedrückt, dass in jedem Menschen etwas von einem ermordeten Mozart steckt.« Unsere Verantwortung ist immens. Ich wiederhole: Immens! Bildung bedeutet, die Kühnheit zu haben, den anderen zu bejahen mit jenem Wort des heiligen Augustinus: »Volo ut sis.« »Ich will, dass du bist.« Das bedeutet »bilden«.
Ein besonders relevanter Bereich für den epochalen Wandel sind die enormen Fortschritte in der wissenschaftlichen Entwicklung und bei technologischen Innovationen. Wir können heute das Aufkommen der digitalen Transformation und der künstlichen Intelligenz mit all ihren Folgen nicht ignorieren. Dieses Phänomen stellt uns vor entscheidende Fragen. Ich rufe die Forschungszentren unserer Universitäten auf, sich mit der aktuellen Revolution zu befassen und ihre Vorteile und Gefahren aufzuzeigen.
Ich möchte jedoch nochmals unterstreichen: Wir dürfen nicht zulassen, dass das Gefühl der Angst siegt. Denkt daran, dass komplexe kulturelle Übergangszeiten sich oft als die fruchtbarsten und kreativsten für die Entwicklung des menschlichen Denkens erweisen. Die Betrachtung des lebendigen Christus gibt uns den Mut, Zukunft zu wagen, im Vertrauen auf das Wort des Herrn, das uns herausfordert: »Wir wollen ans andere Ufer hin-überfahren« (Mk 4,35). Bitte seid keine Lehrer im Ruhestand! Der Lehrer geht immer voran, immer.
Ich danke euch für euer Engagement und bete, dass der Heilige Geist euch in eurer Arbeit erleuchten möge. Maria, der Sitz der Weisheit, möge euch auf diesem Weg begleiten. Ich segne euch alle. Und ich bitte euch, für mich zu beten. Danke!
Copyright © Dikasterium für Kommunikation